Das letzte Mal, dass ich Ferien hatte, war im Oktober des letzten Jahres. Ich machte Wanderungen, Ausflüge und besuchte die OLMA. Jetzt ist bald Juni und ich weiss gar nicht, ob es dieses Jahr eine solche Messe noch geben wird.
Ferien habe ich jetzt eigentlich nur, weil ich dachte, dass ich nächste Woche an die Jagdprüfung gehen würde. Ich habe viel gelernt und mich darauf gefreut, auf die Fragen der Experten gute Antworten zu geben.
Doch auch daraus ist nichts geworden. Die Prüfungen sind für dieses Jahr abgesagt. Das hat mich im März schon recht aus der Bahn geworfen, wohl weil ich so viel Energie ins Lernen und in die Besuche der Kurse gelegt habe. Es fiel mir leicht, denn ich lernte mit grosser Freude und Neugier. Dass ich mit einem Mal mit nichts mehr dastand, war für mich schwierig.
Die Natur war denn auch während des Shutdowns mein Trost: Ich nahm wahr, wie sich alles nach dem Winter wieder aufrappelt, wie die Bäume spriessen, die ersten Blumen erblühen. Dann die Apfelblüte, der Bluescht im Thurgau, die noch schöner erschien als all die Jahre zuvor, wie ich zum ersten Mal auf freier Wildbahn Hasen erblickte, wie ich Rehe nachts beobachtete und die verliebten Elstern in unserer Tanne. Ich habe unzählige wunderschöne Sonnenuntergänge fotografiert und mich an den blühenden Rosen und den zum ersten Mal erblühenden Iris in unserem Garten erfreut.
Ich ging arbeiten wie immer, darüber war ich dankbar. Die Sorge um die Menschen, die wir als Team begleiten, war gross. Es ist eben nicht einfach so, dass man in unserem Beruf nur für sich selber Verantwortung trägt. Das wurde mir sehr klar in den letzten Wochen.
Ich sorgte mich um meine Eltern. Das Gefühl, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie auf sich alleine gestellt sind, beschäftigte mich stark. Mir fehlen unsere Umarmungen, unsere Gespräche am Küchentisch und ich fühle mich traurig, weil ich ihnen nicht so zur Seite stehen konnte, wie ich es wollte. Ich erinnerte mich daran, wie mein Vater und ich im Mai vor neun Jahren gemeinsam eine Krähe aufgezogen und auswildert haben. Wie mein Vater mir vor sechs Jahren gezeigt hat, wie ich eine Wiese von Hand und mit der Fadensense mähen kann. So viel ist passiert in kurzer Zeit.
Glücklich machen mich die Treffen mit den Menschen, die ich sehr schätze und während der letzten Wochen vermisst habe. Ich bin über mich selber erschrocken, wie sehr ich mich zurückgezogen habe. Bin das wirklich noch ich?
Die nächsten Tage werde ich viel schlafen und im Garten arbeiten, Sport treiben und einfach draussen sein. Ich freue mich.












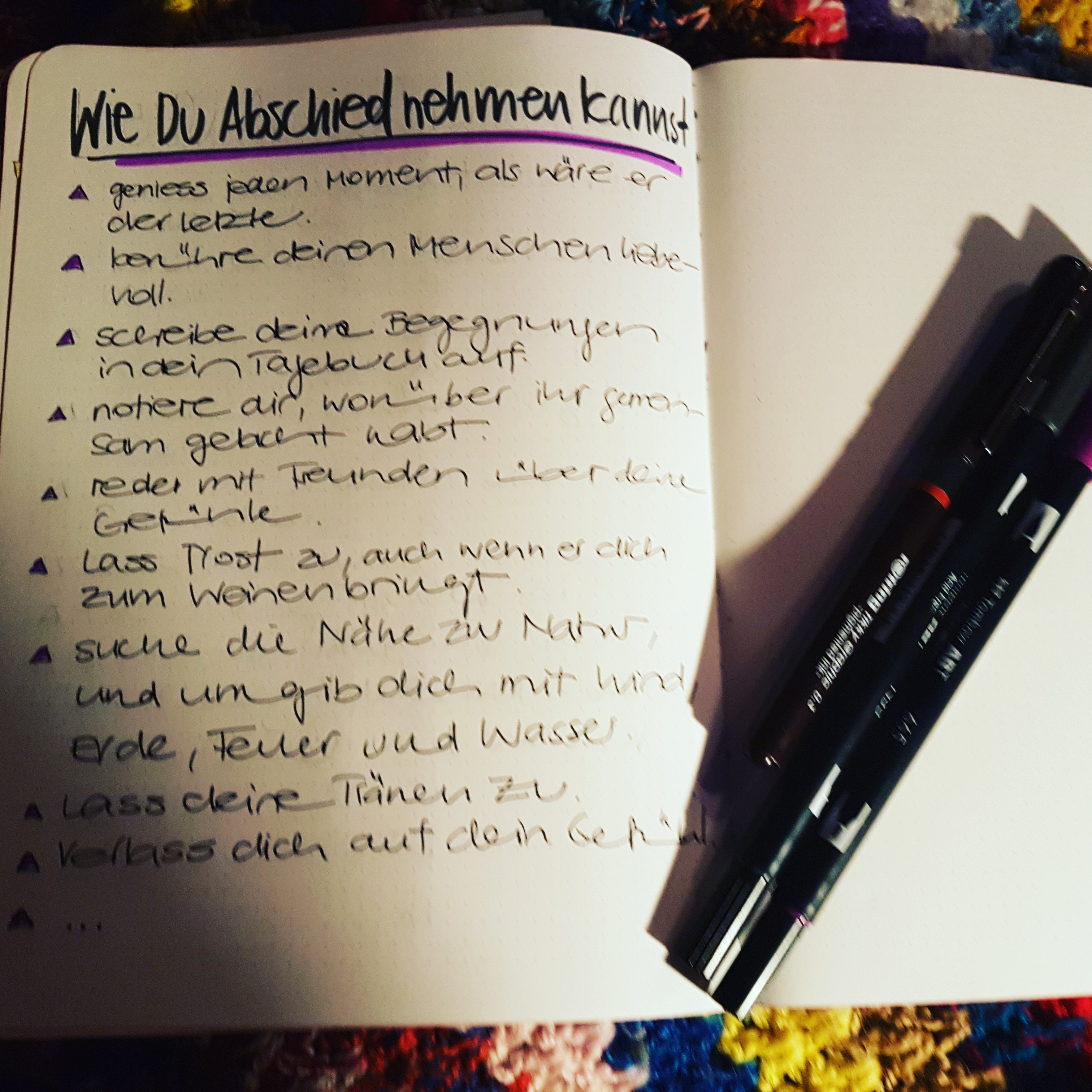





















![20150319_110413[1] 20150319_110413[1]](https://i0.wp.com/demenzfueranfaenger.com/wp-content/uploads/2015/03/20150319_1104131-e1426852742311.jpg?w=122&h=217&ssl=1)
![20150319_110405[1] 20150319_110405[1]](https://i0.wp.com/demenzfueranfaenger.com/wp-content/uploads/2015/03/20150319_1104051-e1426852723368.jpg?w=385&h=217&ssl=1)
![20150319_110351[1] 20150319_110351[1]](https://i0.wp.com/demenzfueranfaenger.com/wp-content/uploads/2015/03/20150319_1103511-e1426852704819.jpg?w=121&h=217&ssl=1)